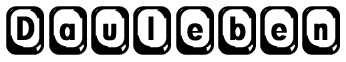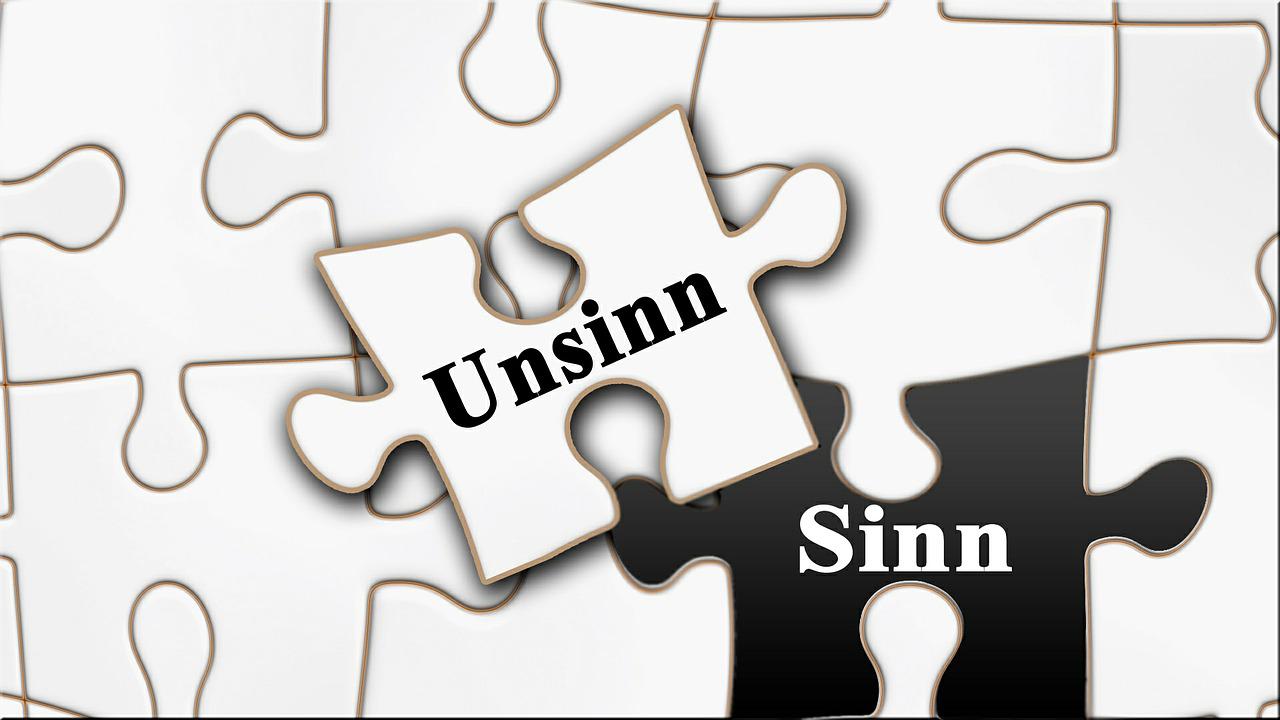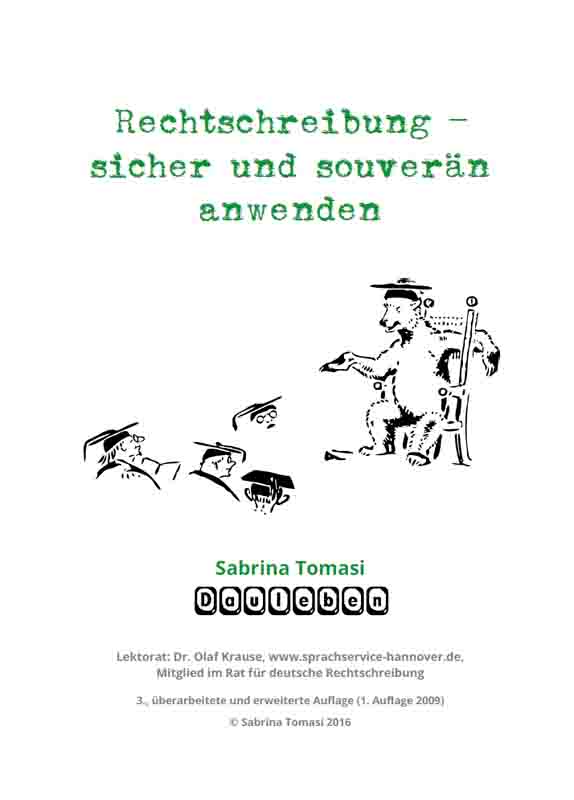Hast Du schon mal von den Anglizismusjägern eins auf den Deckel bekommen, weil Du der Meinung warst, etwas mache Sinn?
Sinn machen: Anglizismus oder nicht?
Wenn Dir das (wieder) passiert, darfst Du gern mit Peter Eisenberg, einem der bekanntesten deutschen Sprachwissenschaftler, im Rücken kontern: Nach derzeitigem Wissensstand handelt es sich bei Sinn machen um keinen Anglizismus, zumindest kann dies nicht belegt werden.
Das Todesurteil über die Sprache als einem lebendigen Phänomen wird endgültig gefällt, sobald seitens unermüdlicher Sprachpuristen die Etymologie ins Feld geführt wird.
So führt der eingangs erwähnte Publizist gegen den (vermeintlichen) Anglizismus „es macht keinen Sinn“ ins Feld, das Verb „machen“ könne nur mit Konkreta gebraucht werden, da es von einer germanischen Wurzel mit der Bedeutung „kneten“ abstamme, und Sinn könne man nicht kneten. Allerdings sei, so Eisenberg, die Verwendung von „machen“ mit Abstrakta bereits im Wörterbuch von Grimm belegt, so z.B. „das macht Freude“.
Ob es sich bei „es macht keinen Sinn“ tatsächlich eine aus dem Englischen übernommene Lehnprägung handele, bleibe so lange eine unbeweisbare Behauptung wie das „Deutsche Textarchiv“ als elektronisch erfasstes Nationalkorpus für das Deutsche (rückläufig vom 20. bis ins 16. Jahrhundert) noch nicht fertig gestellt sei, welches Aufschluss über Erstbelege liefern könne.
Peter Eisenberg, Vortrag vom 12.12.2007, zitiert nach einem Protokoll auf mediensprache.net
Nachdem ich den Artikel Das macht Sinn 2010 auf der kuhhaut veröffentlicht hatte, erklärten mir einige Sprachpuristen in Kommentaren ausführlich, warum etwas nur Sinn ergibt oder hat, aber keinesfalls macht. Stets wurde dabei die konkrete Bedeutung als Maßstab herangezogen; Sinn und machen, das passe nicht zusammen.
Keiner der Kommentatoren ging auf die zentralen Punkte in Eisenbergs Vortrag und in meiner Argumentation ein:
- Die Prämisse, „Sinn machen“ wäre denglisch, ist sehr fragwürdig.
- Niemand regt sich über verwandte Wendungen wie Freude machen oder einen Unterschied machen auf – beide zeigen, dass machen mit Abstrakta verwendet werden kann.
Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis ein Beleg dafür gefunden wird, dass es Sinn machen schon seit langer Zeit im Deutschen gibt – ähnlich wie im Fall von etwas erinnern.
Vorsicht vor sprachlichen Gewissheiten
Der protokollierte Vortrag von Peter Eisenberg ist auch deshalb sehr lesenswert, weil er einige „Gewissheiten“ über Sprache und ihre korrekte Verwendung fundiert infrage stellte.
Eisenberg hob hervor, dass die nicht graduierbaren Antonyme „richtig“ und „falsch“ für die Normierung von Sprache keine geeigneten Kriterien seien, zumal „falsches Deutsch“ bei Licht betrachtet „gar kein Deutsch“ sei.Peter Eisenberg, Vortrag vom 12.12.2007, zitiert nach einem Protokoll auf mediensprache.net
Mir geht’s da selbst an den Kragen, ich stehe nämlich auf Kriegsfuß mit Wendungen des Typs wie wenn oder wie er das sah, überkam ihn Freude (also im Sinne von „in dem Augenblick, als er es sah …“). Auch bei zu was, um was etc. gehe ich auf die Barrikaden.
So ganz kann ich mich mit dem Gedanken, bei der Bewertung von Sprachverwendung auf „richtig“ und „falsch“ zu verzichten, nicht anfreunden. Wenn es kein „Falsch“ gibt, dann darf ich also schreiben: „Haus, gähe auß hoite ich“? Natürlich übertreibe ich hier, Eisenberg aber auch. Er mahnt jedoch etwas sehr Wichtiges an: nicht leichtfertig über inkorrektes Schreiben oder Sprechen zu urteilen.
Der subjektive Faktor
Ich glaube, letztlich sind beide Wahrheiten gültig: Sprache und die Auffassung darüber, was gut klingt, sind subjektiv mitgeprägt und verändern sich. Andererseits muss man nicht über alles frohlocken, was sich da verändert, das eigene Empfinden gehört zur Sprachdiskussion dazu. Für meine Großmutter, die mich in ihrer Liebe zur Sprache geprägt hat, waren wie wenn und Co. Fehler ohne Wenn und Aber. Natürlich bin ich davon beeinflusst.
Irgendwann kann es einen auch selbst erwischen: So durfte ich vor Jahren darüber staunen, dass es nicht ich habe das hier zu liegen, sondern ich habe das hier liegen heißt. Mit zu liegen haben bin ich aufgewachsen. Der grüne Duden gab Auskunft, dass zu in diesem Fall standardsprachlich nicht korrekt sei, es aber im Berlinerischen gebräulich wäre. Alles klar, dort liegen meine Wurzeln.
Ich werde es nicht verhindern können, dass wie wenn sich immer mehr durchsetzt. Doch mein Einspruch bei anders wie ihr Mann bleibt bestehen, weil das nicht nur meinen Augen und Ohren wehtut, sondern zudem inhaltlich überhaupt keinen Sinn macht.
Weiter- und nachlesen
Im Text zitiertes Protokoll von Peter Eisenbergs Vortrag auf mediensprache.net mit dem Titel „Korrektes Deutsch!“ vom 12. Dezember 2007 auf mediensprache.net (Ankündigung des Vortrags: Vortrag Korrektes Deutsch von Peter Eisenberg)
Duden Band 9, Richtiges und gutes Deutsch, 6. Auflage. Dudenverlag 2007, S. 1039, oder Stichwort „zu“
Erstveröffentlichung am 20. Januar 2010 auf meiner alten Website „keine kuhhaut“. Für Dauleben überarbeitet und erweitert.